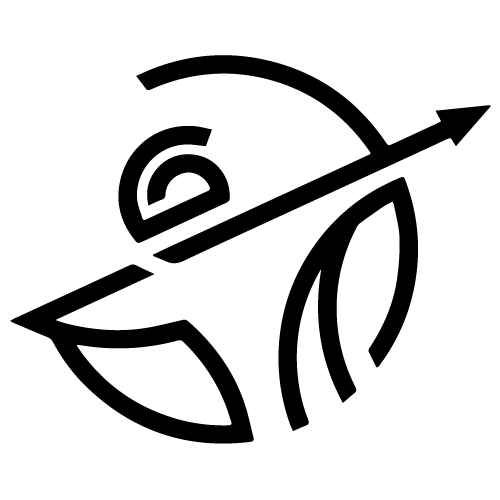Die architektonischen Meisterleistungen unserer schlesischen Vorfahren sind es würdig, dem Vergessen entrissen zu werden. Wir Sachsen sollten uns dabei besonders angesprochen fühlen. Auf einer Tagestour von der Oberlausitz aus lassen sich zwei Gotteshäuser besichtigen, die Mut und Zuversicht verströmen, auch wenn die Widermächte noch so sehr am Drücker sind: die beiden größten Fachwerkkirchen der Welt.
Cuius regio, eius religio
„Beide Seiten gewähren einander immerwährendes Vergessen und Amnestie (perpetua oblivio et amnestia) all dessen, was seit Beginn der Kriegshandlungen an irgendeinem Ort und auf irgendeine Weise von dem einen oder anderen Teil, hüben wie drüben, in feindlicher Absicht begangen worden ist…“ So beginnt (auf Lateinisch) der zweite Artikel des Westfälischen Friedensvertrags von 1648, genauer gesagt, des Osnabrücker Vertrags zwischen dem deutsch-römischen Kaiserreich und Schweden. (Der andere Vertrag von Münster regelt den Frieden des Reiches mit Frankreich.) Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges waren die Kontrahenten darauf bedacht, die jeweiligen Verlierer nicht so zu erniedrigen, dass bald neue Konflikte entstünden. In Schlesien waren die Verlierer die Protestanten – auf ganzer Linie. Der deutsch-römische Kaiser Ferdinand III., ein an sich verständiger und den Musen zugetaner Habsburger, verfügte die komplette Rekatholisierung der Habsburger Lande, was bislang trotz jahrzehntelanger Anstrengungen nicht gelungen war. Cuius regio, eius religio (wessen Region, dessen Religion) war das Friedensmotto noch aus den Religionskriegen des 16. Jahrhunderts. Alle Kirchen mussten den Katholiken überlassen werden. Und das waren viele, denn 90 Prozent der Schlesier waren protestantisch (damals noch getrennt in Lutheraner und Reformierte). Allein in den Herzogtümern Jauer und Schweidnitz waren es über 250 Kirchen und Gemeinden. Anders als für Böhmen wurden den Habsburgern für Schlesien jedoch Zugeständnisse abgerungen: Breslau blieb von der Regel unberührt und die Erbherzogtümer Glogau, Jauer und Schweidnitz sollten sich je eine Friedenskirche (so benannt nach dem Westfälischen Frieden) errichten dürfen – auf eigene Kosten.
Aus vier mach viel!
Die Staatskanzlei der Habsburger in Prag zögerte die konkrete Genehmigung bis 1652 hinaus und verfügte solch rigorose Auflagen, die unter heutigen Bedingungen die von dieser Gnade Betroffenen in Mutlosigkeit stürzen würde: Das Baumaterial durfte nur Holz, Sand, Lehm und Stroh sein, Türme und Schulen waren verboten, das Gebäude durfte von außen gar nicht an ein Gotteshaus erinnern und musste außerhalb der Stadtmauern gelegen sein, also dort, wo auch die Aussätzigen zu bleiben hatten. Die Stadtverwaltung ließ in der Folge die Tore auch gerne mal länger zu, sonntagsmorgens zum Beispiel. Und die hübscheste Schikane – die Kirchen mussten jeweils binnen Jahresfrist fertiggestellt werden. Jede Zuwiderhandlung würde zum sofortigen Abriss führen. Selbst wenn es den Widerspenstigen also gelänge, sollten sie nicht allzu lange ihre irrgläubige Freude an den Konstrukten haben, denn mit Holz und Erde baut man nicht für die Ewigkeit. Zwölf Monate! So schnell können heute nur noch Chinesen bauen, wenn sie ausreichend Maschinen, Beton und Stahl zur Verfügung haben – und natürlich von keinerlei ästhetischen Ansprüchen belästigt werden. Für die Protestanten würde sich der Bau der Kirchen allerdings nur lohnen, wenn sie große Menschenmengen fassen könnten. Denn damals war der Sonntagsgottesdienst Pflichtprogramm für alle – ungeachtet der Entbehrungen, die man auf sich lud, und des überschaubaren Unterhaltungseffekts. (Heute vergleichbar nur noch mit dem Pflichtprogramm für alle, jeden Tag viele Stunden lang das Haupt vor dem Klugfon zu neigen.)
Schneller, höher, weiter!
Am eiligsten hatten es die Glogauer: Die dortige Friedenskirche war bereits 1652 fertig, hielt aber nur bis zum ersten großen Sturm zwei Jahre später. An eine Fachwerkkonstruktion dieser Größenordnung hatte sich bislang noch niemand herangewagt. Die im zweiten Versuch (nach vielen Bitten und Verhandlungen) neu erbaute Holzkirche fiel 1758 dem Feuer zum Opfer, der steinerne Nachfolgebau überlebte den Zweiten Weltkrieg nicht.

In Jauer war man schlauer und wertete die Erfahrungen aus Glogau aus. Der Breslauer Ingenieurleutnant Albrecht von Säbisch, ein Spezialist für Festungsbauten, wollte feindlichen Elementen nun keine Angriffsfläche mehr bieten. In zwei Jahren brachten die Glogauer auf Betteltouren durch Europas protestantischen Norden 4600 Taler zusammen. (Der Jahreslohn einer Köchin war damals 10 Taler.) Der einheimische Zimmermann Andreas Gamper mit seinen Gehilfen war für die Holzkonstruktion der Kirche zuständig. 1655 wurde sie eingeweiht, ein schlichtes, aber riesiges einschiffiges Langhaus für 6.000 Menschen. Man hatte die Glogauer Pleite mit schlesischer Akuratesse studiert. Und so überdauerte die Friedenskirche von Jauer bis zum heutigen Tag und bereitet sich auf ihren 370. Geburtstag vor.
Inzwischen hatten auch die Schweidnitzer das nötige Geld beisammen. Von Säbisch konnte nun seine Kreativität voll ausleben und vervollkommnete das Fachwerkprinzip: Ein dem Langhaus beigefügtes Querschiff sorgte nicht nur für mehr Platz, sondern auch für mehr Stabilität. Nach einem halben Jahr war die Kirche praktisch fertig. Am 24. Juni 1657 fand nach nur zehnmonatiger Bauzeit der erste Gottesdienst in dem neuen Gebäude statt, dessen Grundfläche mit 1090 Quadratmetern zwar etwas kleiner ausfiel als die von Jauer, das aber durch von Säbischs geniale Raumaufteilung sage und schreibe 7.500 Menschen Platz bietet, davon 3.000 auf Sitzbänken. Trotz des weiten Einzugsgebietes kamen Sonntag für Sonntag aus den Dörfern des Umlands viele Tausend Menschen zu Fuß zum Gottesdienst. Man musste mehrere Gottesdienste nacheinander halten, um alle Besucher aufnehmen zu können. Von Jauer werden sechs Gottesdienste hintereinander berichtet.
Unser Erbe
Die Zugfahrt von Görlitz nach Schweidnitz an diesem Sonntagvormittag verläuft ruhig, man könnte sagen andächtig. Die überwiegend jungen Mitreisenden sind endgerätesediert. Der Weg zur Kirche führt über den prächtigen Hauptmarkt. Wer lange nicht in Polen war, wundert sich, dass hier praktisch nur Polen herumlaufen. Coudenhove-Kalergi machte um dieses Land einen Bogen. Für das deutsche Erbe insgesamt ein Glücksfall, denn die Polen pflegen es liebevoll wie bzw. als ihr eigenes, finanziell von Berlin und Brüssel unterstützt. Ein Relief zeigt den Stadtriss im 13. Jahrhundert. Die Flanierenden schlecken am sündhaft teuren Eis, zünftig gekleidete Förster präsentieren den städtischen Forstverein und spendieren Bigosz. Gleich hinter der unsichtbaren Stadtmauer liegt das ummauerte Gelände der Friedenskirche. Durch ein barockes Tor gelangt der Besucher in ein Ensemble duftender alter Laub- und Nadelbäume, zu deren Füßen ein verwildeter Friedhof die Kirche umsäumt. Die efeuumrankten Grabsteine sehen älter aus, als sie sind. Brennnesseln und Brombeersträucher wehren Touristen ab. Wer hier liegt, ist zwar vergessen, aber würde kaum mit woanders Ruhenden tauschen wollen.
Es ist Gold, was da glänzt!
Die Größe und Grazie des Sakralbautes raubt den Atem. Die Fachwerkkonstruktion ist so raffiniert gestaltet, dass man sich fragt: Ist sie wirklich notwendig für die Stabilität oder nur der Schönheit wegen gewählt? Vielleicht beides in einem: Die Schönheit war damals notwendig für die innere Stabilität. Und was lange halten würde, war schön. Der Koloss lädt zu jeder Seite mit insgesamt 17 Türen ein. Viele Türen führen zum Heil. (Die prosaische Erklärung: Die Adelsfamilien bauten sich ihre eigenen Logen mit separaten Zugängen.) Innen der erste Eindruck: Um es nicht so karg und kantig aussehen zu lassen, hat man später diese ganzen barocken Üppigkeiten aus bunt bemaltem Stein und Metall eingefügt. Der Eindruck täuscht! Zwar wurden die meisten Einzelwerke wie die Kanzel, der Altar und die vielen verzierten Rahmen mit Bildnissen hervorragender Zeitgenossen in den Jahrzehnten nach der Eröffnung eingepflegt, aber streng nach Vorschrift nur aus Holz und Lehm! Das Reinheitsgebot wurde später allein durch die Orgelpfeifen umgangen, auch nachdem das protestantische Preußen 1742 die Provinz übernahm.
Niemand mehr da
Die Kirche ist an diesem Sonntag von Touristen gut besucht. Ganz selten fallen deutsche Laute. Allzu lange kann man nicht im Schiff verweilen, weil die Endlosschleife des über die Lautsprecher tönenden polnischen Audioprogrammes nervt. Es lohnt sich, eine Orgelspieleinlage abzuwarten, von der die Körperzellen vibrieren. Draußen komme ich mit einem jungen Mann ins Gespräch, der sorgfältig Fotos erstellt: „Ich wohne hier und komme ständig zum Fotografieren vorbei. Das ist so meisterhaft, dass ich jedes Mal neue Motive entdecke. Nur die Deutschen konnten so etwas bauen!“ Umso angenehmer zu hören, da ich immer für einen Polen gehalten werde. Warum sollte jemand sonst Polnisch sprechen? Die monoethnischen Kulturen sind schon putzig in ihrer Selbstgewissheit. Die letzten Gottesdienste auf Deutsch wurden vor Corona abgehalten, einmal im Monat. Früher waren es alle zwei Wochen. „Jetzt ist fast niemand mehr da.“ 1945, vor der massenhaften Enteignung und Vertreibung der Deutschen, waren es 17.500 Evangelische im Sprengel der Friedenskirche.
Wie konnte diese Bauleistung erbracht werden?
Vor allem durch das konzertierte Zusammenwirken der ganzen Einwohnerschaft. Jeder trug seinen Scheffel bei. (Nach dreißig Jahren Krieg und Pestilenz waren es freilich nur noch wenige Hundert.) Der Rat der Stadt holte für den Bau 1000 Stämme aus dem Stadtwald, der größte Teil des Holzes stammte aber aus den Wäldern von Hans-Heinrich von Hochberg auf Fürstenstein. Aus Dankbarkeit erhielt die Familie in der Kirche eine eigene Fürstenloge: 2000 Eichen spendierte der Edelmann dem Bau. Vor Eichen weicht der Zahn der Zeit! Des Weiteren war das Seelenheil ein starker Motor, zumal wenn es vom braven Besuchen des Gottesdienstes abhängt. Das hohe handwerkliche Niveau der Ausführenden ist ein weiterer Faktor. Nicht zuletzt, vielleicht sogar in erster Linie, ist es gerade die schikanöse Einschränkung, die Wunder wirkt. Erst der Lebensdruck bringt den Zauber der Evolution hervor, erst die Repression den Freiheitswillen, erst die Depression das Spiel der Phantasie und erst die Restriktion die Ausweitung der Möglichkeiten. Weniger ist mehr, das gilt in der Diät wie in der Kunst – vorausgesetzt, die Seele ist noch intakt. Denn von ihr kann es nie genug geben. Wer weiß, vielleicht sind außerdem Kenntnisse genutzt worden, die der heutigen materialistischen Vorstellungsarmut nicht entsprechen und nicht überliefert wurden?
Nacheifernde Kinder
1707 wurde den Gemeinden erlaubt, Türme und Glocken hinzuzufügen – mit 50 Metern Abstand von der Kirche. Seit 1708 ziert ein Fachwerk-Glockenturm das Gelände. Er diente als Verlies für ungehorsame Schüler der nun ebenso erlaubten Kirchschule. So schmorte in ihm auch der Dichter Johann Christian Günther, der als Vorläufer der Romantik gilt. Womöglich erfuhr er hier bei Wasser und Brot seine Initialzündung. Ein weiterer berühmter Sohn der Stadt passt in diese Reihe: Johann Siegmund Hahn (1696–1773), Verfasser des Buchs „Unterricht von Krafft und Würckung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen“, das zur Grundlage der Kneipp-Kur wurde.
Allmählich entstand ein kleiner Staat im Staat. Die Ummauerung schützte vor Angriffen und Feuer. Schäden wurden ausgebessert, auch wenn es manchmal etwas dauerte. Eine Inschrift am Haupteingang lautet: „1693 von frommen Eltern erbauet. Durch Krieg verwüstet 1756 u. 1762, von nacheifernden Kindern hergestellt 1788.“
Dann kam das menschenfressende 20. Jahrhundert. Nach 1945 wurde eine Umwandlung der Kirche in ein Museum oder ein katholisches Gotteshaus diskutiert; immerhin nicht in einen Pferdestall oder ein Schwimmbecken, wie es der große sowjetische Bruder vorlebte. Schließlich konnte die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen ihre schützende Hand ausbreiten. Der Kommunismus (der Vor-Schwab’schen Prägung) verabschiedete sich gerade noch rechtzeitig, damit (mit deutschen Geldern) die überfällige Innensanierung begonnen werden konnte. Sie wurde 2002 aus finanziellen Gründen abgebrochen. (Auch damals gab die rot-grüne Regierung lieber Geld für Kriege als für Kultur aus.) Als man mit „Frieden“ politisch noch punkten konnte, trafen sich hier mit ihren polnischen Kollegen 1989 Helmut Kohl und 2014 Angela Merkel. Auch ein Dalai Lama ließ sich die Chance auf ein publikumswirksames Friedensgebet nicht entgehen. Jeden Juli finden die Bachtage statt, dieses Jahr vom 18. bis 28. Juli.
Vor der Haustüre
Die Kirche in Jauer ist bequem auf der Trasse zwischen Schweidnitz und Liegnitz zu erreichen, aber der Pendelverkehr nach Sachsen ließ am Nachmittag die Züge überquellen, so dass ich mich mit der Gewissheit begnügte, dort ein nicht minderes Meisterwerk vorzufinden. Die Kirche traf nach 1945 ein härteres Schicksal als ihre Schwester in Schweidnitz: Ohne verbliebene Gemeindemitglieder konnte der neue Staat das Drumherum enteignen und verhinderte auch Plünderungen nicht. Die Innenausstattung glänzt aber heute um die Wette mit dem Innenraum der Schweidnitzer Kirche. Gleich vier Galerien verleihen dem Bau die Form eines barocken Theaters.
Der Ausflug macht Lust auf ein vertieftes Studium der Fachwerkkultur. Trotz der erheblichen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg haben sich in Deutschland um die 2,4 Millionen Fachwerkbauten erhalten. 88 Fachwerkkirchen hat es auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands bis ins 20. Jahrhundert gegeben. Drei von vier in Sachsen erhaltene Kirchen stehen in der Oberlausitz: in Bluno, Pechern und Spreewitz. Die Leipziger haben ihre Auferstehungskirche, ein ebenfalls die Zeit überdauerndes Provisorium. Ein Grund, warum Holzkirchen so berühren, ist sicher auch die genetisch nähere Verwandschaft des Menschen zum Baum als zum Stein. „Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt“, sangen die Puhdys.
Wer tiefer in die Archive um die Friedenskirchen einsteigen möchte, sei an kirchliche Stiftungen wie etwa „Evangelisches Schlesien“ verwiesen.
■ Jochen Stappenbeck
Abonniert unseren Telegram-Kanal https://t.me/aufgewachtonline
Kostenlose AUFGEWACHT-Leseprobe herunterladen: https://aufgewacht-online.de/leseprobe/