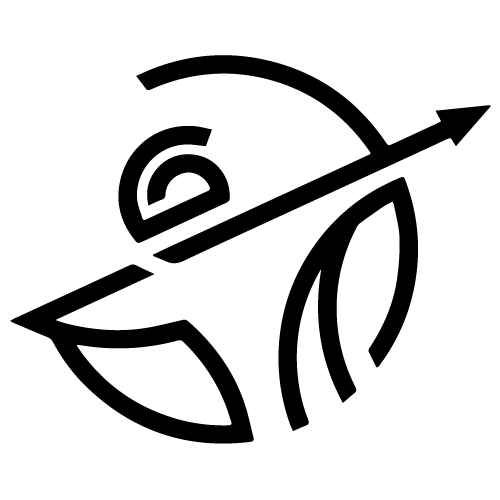BRD-Diktatur: Gesichert linksextrem! Dieses Heft könnte brandaktueller kaum sein. In dem Heft finden sich Artikel zum anstehenden Prozess gegen COMPACT vor dem Bundesverwaltungsgericht, zum Verbot des „Königreich Deutschland“ (KRD), zur Verfassungsschutz-Beobachtung der AfD sowie Interviews mit dem COMPACT-TV-Chef Paul Klemm und dem Bayernpartei-Ehrenvorsitzenden Andreas Settele. HIER vorbestellen!
Dies ist der zweite Teil einer zweiteiligen Folge. Den ersten Teil dieses Textes lesen Sie hier. Mehr Texte von Sascha Roßmüller gibt es auf seinem Substack-Portal https://rossmuellerreport.substack.com.
Migration birgt mehr Herausforderungen und Gefahren als Gelegenheiten, wobei sich der jeweilige Grad neben der Zahl der Zuwanderer an deren kultureller Nähe und Anpassungsfähigkeit bemisst. Auch hier gelingt die Integration nur dann, wenn ein leitkulturelles Identifikationsangebot vorliegt, was wiederum die Bedeutung von Werten und Traditionen unterstreicht. Mit Blick auf die Sozialsysteme des Ziellandes von Zuwanderung, dürfte hinsichtlich der Arbeitsjahre und des Beitrags für die Sozialsysteme ohnehin einzig und allein hochqualifizierte Zuwanderung nutzbringend sein. Ebenso sollte man nicht außer Acht lassen, dass wiederum ein zu hoher „Brain Drain“ aus bevölkerungsreichen Entwicklungs- und Schwellenländern dem Ziel globalen Wirtschaftens insofern widerspricht, da hierdurch chronisch rückständige Nationen nicht in die Lage gelangen, in relevantem Maße ihre Potenziale auszuschöpfen, um aufzuholen und als Konsumenten auf dem Weltmarkt auftreten zu können.
Hohe Zuwanderung verschärft in der Regel nur die Konkurrenz im weniger qualifizierten Segment, wo sich die Situation ohnehin aufgrund des technologischen Fortschritts verschärft. Zunehmende Inhomogenität und erhöhter Prekariatsdruck können die soziale Kohärenz einer Gesellschaft erheblich gefährden. Was die Zuwanderung Hochqualifizierter betrifft, sind gerade für dieses Klientel die sogenannten weichen Standortfaktoren, sprich das Angebot an kulturellen Einrichtungen eines Landes, von Bedeutung, um dem Anspruch an gehobener Muße, der mit einem hochstehenden intellektuellem Hintergrund zumeist einhergeht, gerecht zu werden.
Fortschritt, um voranzuschreiten
Das Potenzial von Menschen ohne Arbeit droht zu verkümmern, sprich deren „Humankapital“ schmilzt ab. Künstliche Intelligenz und technologisch-organisatorische Effizienzsteigerungen, welche die Arbeitsproduktivität erhöhen, mögen zweifelsohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern, führen sie jedoch zu spürbar höherer Erwerbslosigkeit, lässt eine Nation langfristig potenzielles Humankapital ungenutzt. Fortschritt muss mit Aufgabenerfüllung verknüpft werden, damit die Gesellschaft in der Breite „mitzuschreiten“ vermag, und dies nicht allein ein Eliten-Projekt bleibt, andernfalls ist es ein Fortschritt ohne voranzukommen. Grundsätzlich ist bei aller Bedeutung geisteswissenschaftlicher Disziplinen ohne Frage wichtig, auf grundsolide schulische Lehrpläne in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik zu achten, um nicht von der immer rasanter verlaufenden technologischen Entwicklung abgehängt zu werden. Der Arbeitsmarkt der Zukunft darf allerdings ebenso wenig wie die Demographie als unabänderlich betrachtet werden, der lediglich noch Anpassung an gleichsam selbsterfüllende Prophezeiungen und keine pro-aktive Gestaltung mehr duldet. Schließlich ist es illusorisch zu glauben, eine vollumfänglich hochqualifizierte Fachkräftegesellschaft zu erreichen, jedoch ist dennoch grundsätzlich Arbeit mehr als nur Broterwerb und Sicherung des Lebensunterhalts, sondern auch sinnstiftend und sozialisierend. Diese soziale Komponente von Arbeit hat in der arbeitsmarktpolitischen Gestaltung Berücksichtigung zu finden, beispielsweise durch öffentlich geförderte Sektoren.
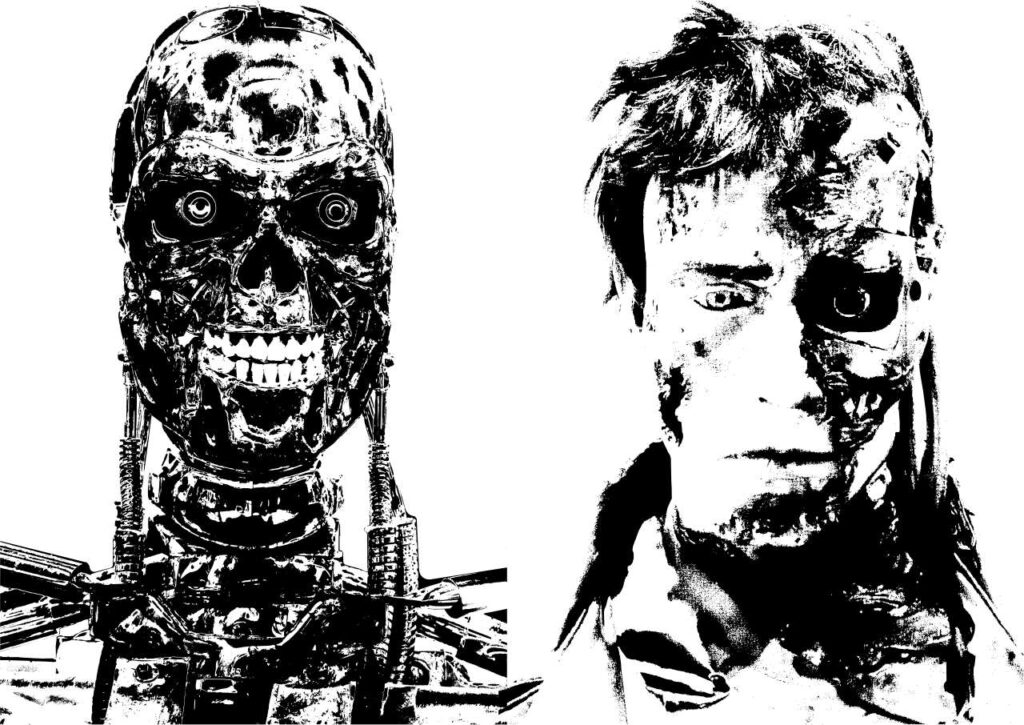
Auch was die digitale Kluft zwischen den Gesellschaftsschichten bzw. Generationen anbelangt, wird allen Maßnahmen der schulischen Schwerpunktbildung und/oder Erwachsenenbildung zum Trotz, stets nur eine Verringerung, jedoch nicht die völlige Beseitigung dieser Kluft gelingen. Deshalb wird man gut beraten sein, ehe man sich verrennt, an der Quadratur des Kreises zu scheitern, auch in Zukunft analoge Lebenswelten alternativ aufrecht zu erhalten, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, v.a. auch weil nicht auszuschließen ist, dass manche sich nicht aufgrund von Unkenntnis, sondern aus anderen Beweggründen bewusst sich einer zu sehr ausufernden digitalen Vereinnahmung verschließen wollen. Da dies vermutlich nicht die unkritischsten Zeitgenossen sind, sollte sich der Staat der Potenziale dieser Klientel nicht berauben. Im Wesentlichen werden jedoch der technologische Fortschritt und die Innovationssprünge im Bereich der Künstlichen Intelligenz eine weitreichende Veränderung zur Folge haben, die den privaten Alltag, den Arbeitsmarkt, die Bildung verändern wird, aber auch zahlreiche offene Fragen, wie beispielsweise im Markenrecht, zur Klärung hinterlassen.
KI: Das Ende des kritischen Denkens?
Gerade mit Blick auf Humankapital darf allerdings nicht versäumt werden festzustellen, dass die Veränderung der digitalen Technologie und Künstlichen Intelligenz im Bereich des Lernens nicht nur vorteilhafte Folgen zeitigen, indem bereits nachgewiesen wurde, dass vermehrte KI-Nutzung auch den Prozess des kritischen Selbstdenkens beeinträchtigen kann. Der erleichterte Informationszugang verringert ohne Hilfsmittel verfügbares Basiswissen und trägt zur Verkümmerung so mancher Kompetenzen bei. Zu „googeln“ oder eine AI zur Hilfe zu nehmen, verhilft zumindest nicht dazu, die eigene Fähigkeit zu verbessern, Sachverhalte zu vertiefen und Zusammenhänge nachvollziehend zu verstehen. Eine Gesellschaft, die hier rechtzeitig und geschickt über eine dementsprechende pädagogische Ausbildung gegensteuert, wird in Sachen Humankapital womöglich zur wettbewerbsfähigeren Nation werden.
Grundsätzlich darf auch eine gewisse Begabtenförderung nicht vernachlässigt werden, in Kenntnis dessen, dass eine modern gewordene Inklusion zur bildungsleeren Hülse wird, wenn die Frage ausgeblendet wird, in was inkludiert wird. Chancengerechtigkeit statt „Gleichbeterei“ ist entscheidend, da ein „Level-Playing-Field“ bezüglich Begabung außerhalb der Reichweite von Erziehung liegt. Spezielle Bildungseinrichtungen und speziell ausgebildete Förderpädagogen sind sowohl für lernschwache als auch hochbegabte Kinder und Jugendliche zielführender als oftmals nur ideologische Inklusionshalluzinationen basierend auf der Fehlannahme, es gäbe so etwas wie völlig voraussetzungsloses Lernen. Höchstes Augenmerk auf die Eignung zum Lehrberuf gehört somit zum bildungspolitischen Alpha und Omega.
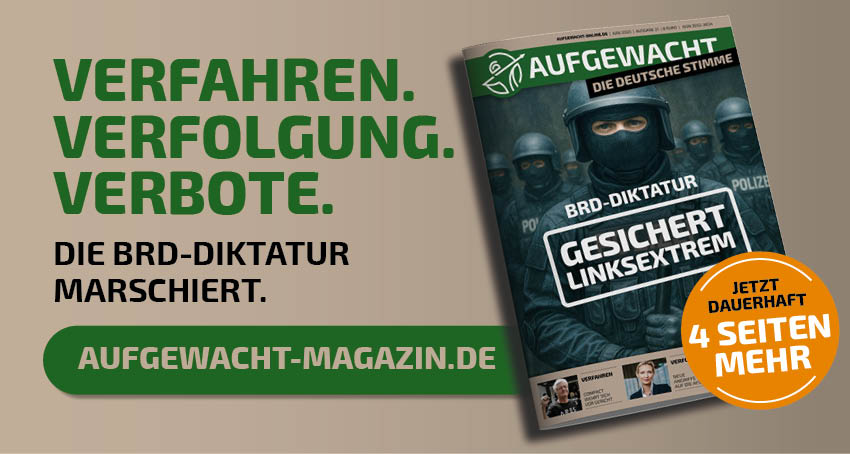
Das gesellschaftliche Wohlbefinden dürfte bezüglich der kollektiven Dimension von Bedeutung sein, wie optimistisch oder pessimistisch die Mehrheit in Fragen der inneren wie äußeren Sicherheit und Wohlstandsentwicklung in die Zukunft blickt. Insbesondere in Zeiten geopolitischer Paradigmenwechsel wird viel davon abhängen, ob eine nachvollziehbare Zielsetzung der politischen Führung erkennbar vorliegt, die konsistent und berechenbar ist. In einer Vertrauensgesellschaft herrscht auch mentale Stabilität, ohne die, ungeachtet Sportförderung und öffentlicher Vorbilder, schwerlich ein allgemein wünschenswerter physischer Zustand erreichbar sein wird. Grundsätzlich ist ein gesunder Lebensstil Ausdruck einer gewissen Selbstachtung, und fällt nicht zuletzt dadurch in den Bereich der Persönlichkeitsbildung, was wiederum den prägenden Lehrkörper einer Nation nicht allein nur auf die inhaltliche Wissensvermittlung reduziert.
Indem bereits die Definition von Humankapital dessen komplex-interdependenten Charakter aufzeigt, wird ersichtlich, dass ein diesbezüglich politischer Ansatz nicht weniger interdisziplinär ausfallen darf, soll er nicht ineffizientes Stückwerk bleiben. Weiter wird das Verstehen der Größe Humankapital nicht allein aus einer Analyse statistischer Daten herzuleiten sein, weil es dabei eben nicht allein um Kapital geht, sondern sozio-kooperative Prozesse, die gewissen Verhaltensprädispositionen unterworfen sind. Nicht zuletzt spielt sogar die Psychologie mit hinein, indem der entscheidende Aspekt der Leistungsbereitschaft nicht losgelöst von einer diesbezüglichen Motivation ist. Der Mensch als Träger des Humankapitals darf sich jedenfalls durch diesen Terminus nicht degradiert angesprochen fühlen, sondern in seiner Wertschätzung adressiert.
Sascha A. Roßmüller
Abonniert unseren Telegram-Kanal https://t.me/aufgewachtonline
Kostenlose AUFGEWACHT-Leseprobe herunterladen: https://aufgewacht-online.de/leseprobe/