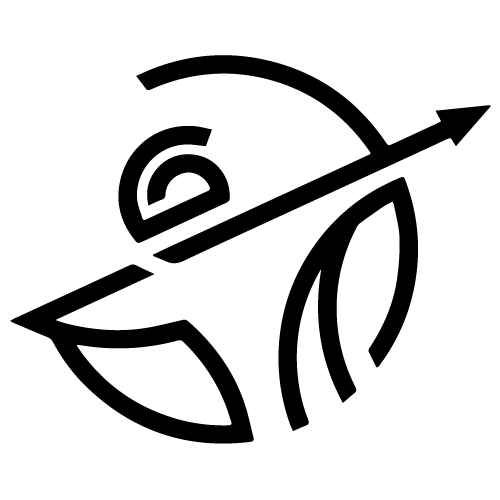Die neue Ausgabe von AUFGEWACHT –DIE DEUTSCHE STIMME ist da! Die April-Ausgabe „Gier nach Krieg: Für Selenskyj in den Staatsbankrott“ zeigt, wie die die schwarz-rot-grüne Schuldenkoalition Deutschland in den Abgrund treibt – während Milliarden in die Ukraine fließen. HIER zu bestellen!
Zölle sind angesichts der US-Handelspolitik derzeit das heißeste Thema der Wirtschaftspolitik. Unser Autor hat sich grundlegende Gedanken zum Thema gemacht. Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Folge. Mehr Texte von Sascha Roßmüller gibt es auf seinem Substack-Portal https://rossmuellerreport.substack.com.
Ein endgültiges Urteil über Trumps Zollpolitik zu fällen, ist noch etwas verfrüht. Eines ist jedoch sicher: Das dürfte ein spannendes Studienfeld für all jene ökonomischen Freidenker sein, die über Alternativen zur freihandelsextremistischen Hyperglobalisierung nachdenken, die statt der vermeintlichen komparativen Kostenvorteile David Ricaros zahlreiche sozioökonomische Kollateralschäden verursacht. Wie dem auch sei, um es gleich auf den Punkt zu bringen: Ich halte die letztgenannte Wirtschaftstheorie, auf der die heutige Freihandelsdoktrin weitgehend beruht, aus ganzheitlicher Sicht für unzutreffend. Wir müssen Wirtschaftszyklen, qualitativen oder schädlichen Wettbewerb, gesundes oder metastasierendes Wachstum und die Rolle des Kapitals neu überdenken, wenn wir aus dem ewigen Kreislauf von wirtschaftlichen Strohfeuer und wiederkehrenden Krisen ausbrechen wollen.

Ein entscheidender sozioökonomischer Aspekt, der im Zuge kurzsichtiger Cashflow- und Renditebetrachtungen aus dem Blickfeld gerät, ist die eigenständige Lebensfähigkeit von Regionen, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt, dass ein zu hohes Maß an wirtschaftlicher Abhängigkeit nicht nur mögliche Risiken erhöht, sondern auch die gesellschaftliche Selbstbestimmung einschränkt. Globalisierung ist kein alternativloses Naturgesetz, das plötzlich vom Himmel gefallen ist, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen, die analysiert, hinterfragt und auch verändert werden können.
Zölle: Der derzeit heißeste Shit der Wirtschaftspolitik
Die zollpolitischen Initiativen der Trump-Administration werden zu einem heißen wirtschaftspolitischen Thema, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass wir mit den Mainstream-Wölfen heulen müssen. Zum Teil wird Trump an der Aushandlung von Zöllen arbeiten, die auch mit nicht-wirtschaftlichen Themen verbunden sind. Dennoch sieht er die Zölle in erster Linie als Druckmittel, um ausländische Unternehmen zu Investitionen in den USA zu zwingen. Zölle als Instrument, um den internationalen Wettbewerb im eigenen Land anzusiedeln. Zudem verzerren Zölle nicht zwangsläufig „den“ Markt, sondern können möglicherweise einen bestimmten Markt gestalten und organisieren oder sogar eine Korrektur eines fehlerhaften Handelssystems sein.

Im Zuge der Trump’schen Zolldiskussion sind einige Aktien, überwiegend spekulative Werte – die in den letzten Jahren gestützt wurden -, kürzlich eingebrochen. Jared Woodard von der Bank of America verneinte jedoch eine Wirtschaftskrise und erklärte, der Ausverkauf sei eine Rotation aufgrund einer Neubewertung des Risikos durch die Anleger wegen eines fiskal- und geldpolitischen Übergangs. Wenn er Recht hat, löst Trumps Zollpolitik lediglich eine Rekalibrierung innerhalb eines neuen, langfristig solideren Marktumfelds aus. Untersuchungen der Federal Reserve Bank of Atlanta zeigen, dass die tatsächlichen Auswirkungen von Trumps Zöllen auf die Verbraucherpreise mit einem geschätzten Anstieg von nur 0,81 bis 1,63 Prozent bescheiden ausfallen werden.
Das Metzler-Paradox: Keine vorschnellen Urteile über Zölle
In der Tat ist es schwer zu erkennen, dass eine selektive und vor allem angebotsorientierte Zollpolitik im Vergleich zu den früheren Defizitausgaben, die durch die Verpflichtung der DOGE (also der Bundesbehörde zur Erhöhung der Regierungseffizienz) ersetzt wurden, ein größeres Inflationsrisiko darstellt. Eine Studie der Ökonomen Alberto Cavallo, Gita Gopinath, Brent Neiman und Jenny Tang analysierte die Auswirkungen der 2018 eingeführten Zölle. Sie fanden heraus, dass die Importpreise zwar fast direkt proportional zu den Zöllen stiegen, die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise jedoch weitaus geringer waren. Finanzprofessor Michael Pettis von der „Carnegie Endowment for International Peace“, ein bekannter Analyst globaler Handelsungleichgewichte, argumentiert seit langem, dass Handelsdefizite nicht einfach das Ergebnis von Verbraucherpräferenzen sind, sondern von bewussten politischen Entscheidungen angetrieben werden.
Nicht zuletzt erinnert das so genannte Metzler-Paradoxon nach dem Ökonomen Lloyd Metzler daran, dass die Einführung von Zöllen die Handelsbedingungen so verbessern kann, dass die Inlandspreise für importierte Waren, die dem Zoll unterliegen, tatsächlich fallen. Vor dem Gespenst des William McKinley braucht man sich also wahrscheinlich nicht zu fürchten.
Sozio-regionale Strukturen
Die Protagonisten des Neoliberalismus bemühen sich seit langem, ihr globales Ziel eines deregulierten und privatisierten Weltmarktes auf der Basis des Freihandels zu verwirklichen – eines Marktes, der letztlich nur noch den Gesetzen des spekulativen Kapitals unterworfen sein wird. Darüber hinaus wird immer wieder viel von Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Allerdings ausschließlich im Rahmen einer immer stärker globalisierten Wirtschaft, zunehmend mit der Folge einer Aushöhlung der produktiven Wirtschaftssubstanz durch einen profitorientierten Verdrängungswettbewerb, der die gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnisse des Wirtschaftens überwiegt. Deshalb ist es eine ordnungspolitische Notwendigkeit, dass Marktgesetze sozioökonomisch begrenzt werden, wenn sie beginnen, verheerende Auswirkungen auf eine Region zu haben.
Sascha A. Roßmüller
Der zweite Teil dieses Beitrags wird demnächst veröffentlicht.
Abonniert unseren Telegram-Kanal https://t.me/aufgewachtonline
Kostenlose AUFGEWACHT-Leseprobe herunterladen: https://aufgewacht-online.de/leseprobe/