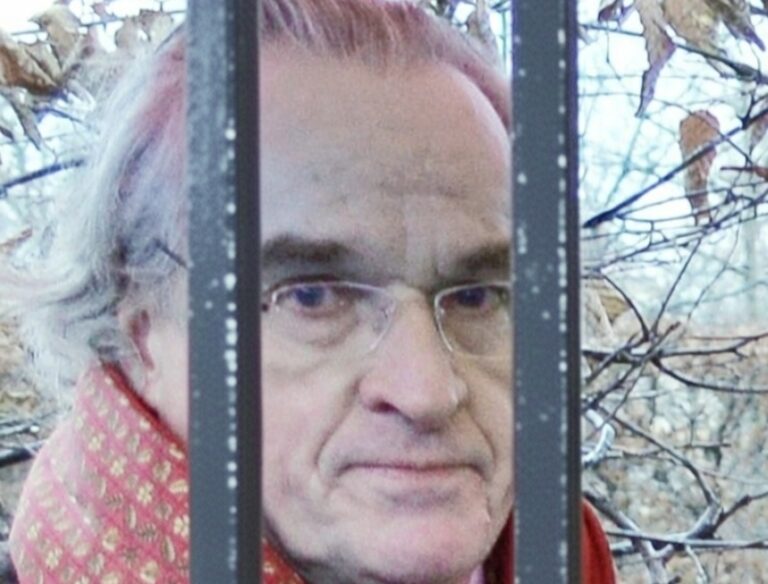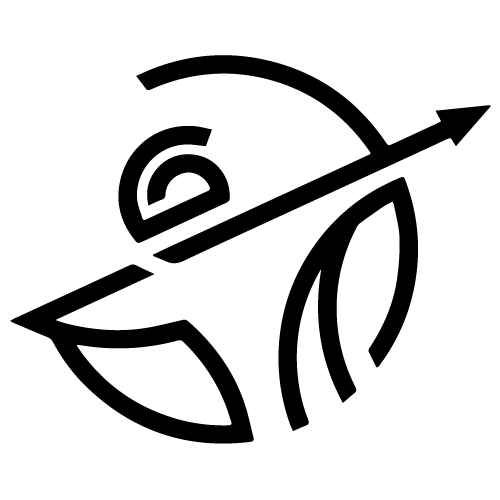Alles über Partei- und Vereinsverbote sowie politische Repression in der Bundesrepublik Deutschland erfahren Sie in unserem Sonderheft „COMPACT-Verbot: Faesers Frontalangriff“. Hier bestellen.
Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Folge. Den ersten Teil lesen Sie hier.
Nach der Einstufung der Bundes-AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ durch das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine weitere Debatte über ein Verbot der Partei losgebrochen. Wie schwierig ein solches Verbotsverfahren für die Antragsteller werden würde, macht schon ein Blick auf die beiden NPD-Verbotsverfahren deutlich, die das Thema dieser zweiteiligen Artikelserie sind.
Am 22. Januar 2002 platzte dann eine Bombe, die zumindest auf kritische Bürger durchaus verstörend gewirkt haben dürfte. Das Bundesverfassungsgericht setzte völlig überraschend die Termine zur mündlichen Verhandlung ab, da zunächst „prozessuale und materielle Rechtsfragen“ zu klären wären. Ein Abteilungsleiter des Bundesinnenministeriums hatte die Karlsruher Richter telefonisch davon unterrichtet, „dass eine der zur mündlichen Verhandlung geladenen Anhörungspersonen eine Aussagegehnmigung eines Landesamtes für Verfassungsschutz vorlegen“ werde. Es handelte sich um den langjährigen NPD-Spitzenfunktionär Wolfgang Frenz.
Da dieser trotz seiner V-Mann-Tätigkeit in allen drei Verbotsanträgen ausgiebigst zitiert worden war – seine Aussagen machten bis zu einem Drittel des vorgelegten Belegmaterials aus – war eigentlich sofort klar, dass hier ein nicht mehr heilbares Verfahrenshindernis vorlag. Mahler hatte sehr früh die große Bedeutung der V-Mann-Frage für den Prozess erkannt. Zwischenzeitlich hatten selbst einige NPD-Mitglieder an ihrem Anwalt gezweifelt. Seine über 250-Seiten lange Stellungnahme zum Verbotsantrag der Bundesregierung wirkte eher wie ein philosophisches Großtraktat.
Horst Mahlers Triumph
Es enthielt Überschriften wie „Herder zum Begriff der Humanität und zur Bdeutung der Verschiedenheit der Völker und Rassen“, „Wirtschaftswunder des Dritten Reiches“ oder „Zur Hegel`schen Logik“. Doch das Scheitern der Verbotsanträge war dann der juristischen Brillianz des Alt-68ers geschuldet. Wie schon in seiner Zeit als aufstrebender und erfolgreicher Wirtschaftsanwalt in den frühen 60er Jahren und als Rechtsvertreter der APO legte der gebürtige Schlesier großes Augenmerk auf die Rechtmäßigkeit der Verfahrenstechnik sowie die Einhaltung der Prozessordnung.

Und so scheiterten die Antragsteller an ihrer mangelnden Bereitschaft, Transparenz in der V-Mann-Frage herzustellen. Ihr Angebot eines geheimen In-Camera-Verfahrens, in dem die Karlsruher Richter Akteneinsicht bekommen hätten, die NPD aber von allen die V-Leute betreffenden Informationen ausgespart worden wäre und dazu auch keine Stellung hätte beziehen können, lehnten die Karlsruher Richter ab. Drei der sieben Richter des Bundesverfassungsgerichts folgten Mahler 2003 insofern, als dass sie durch die nachrichtendienstliche Überwachung der Partei das Verfahren als unheilbar beschädigt ansahen und mit dieser Sperrminorität die Einstellung des Verfahrens erreichten. Nach dem Scheitern des ersten NPD-Verbotsverfahrens konnte sich kaum jemand vorstellen, dass noch ein zweites folgen sollte – zumindest eine rudimentäre Lernfähigkeit hatte man der politischen Klasse zugetraut. Doch am 3. Dezember 2013 wurde erneut ein Antrag auf Verbot der NPD beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.
Antragsteller war diesmal nur der Bundesrat. Treibende Kräfte der Initiative waren in erster Linie die SPD-Innenminister in den Ländern sowie der bayerische CSU-Innenminister Joachim Herrmann. Auch diesmal war der Antrag eine reine Symbol- oder Ersatzhandlung. Nach dem Auffliegen des sogenannten Zwickauer Trios am 4. November 2011 hätten eigentlich die deutschen Verfassungsschutzbehörden aufgelöst gehört, denen mit Blick auf die Mordserie mindestens eklatantes Versagen – wenn nicht mehr – vorzuwerfen war. Die NPD als Partei hatte hingegen mit der Verbrechensserie nichts zu tun, auch wenn später ein Verfahren gegen einen einzelnen Funktionär eröffnet wurde. Einmal mehr war die älteste noch bestehende Rechtspartei Deutschlands zur Projektionsfläche geworden.
Gefährliche Kinderfeste
Dabei darf man das zweite NPD-Verbotsverfahren wohl als einen noch größeren Schildbürgerstreich als das erste bezeichnen. Nicht nur, weil die politische Klasse offenbar rein gar nichts aus ihrem Scheitern im Jahr 2003 gelernt hatte, sondern auch, weil der Blick auf Deutschland verengt blieb. 2013 lag aber schon eine gefestigte Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zu Parteiverboten vor, mit der die Hürden nochmals deutlich höher gelegt wurden. Jetzt kam es auch auf die „Potentialität“ an. Demnach muss eine verbotswürdige Partei auch eine realistische Chance haben, ihre Ziele zu verwirklichen und Wahlergebnisse erzielen, die eine Regierungsübernahme zumindest als denkbar erscheinen lassen.
Dieses Kriterium war bei der NPD aber nie erfüllt. Als am 1. März 2016 die mündliche Verhandlung in Karlsruhe eröffnet wurde, hatte die AfD in den Parlamenten und Pegida auf der Straße der NPD schon den Rang abgelaufen. Schon während der Anhörung der Innenminister von Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, Joachim Herrmann und Lorenz Caffier, kam es zu einer für die Antragsteller peinlichen Szene, die schon erahnen ließ, wie dieser Prozess ausgehen würde.
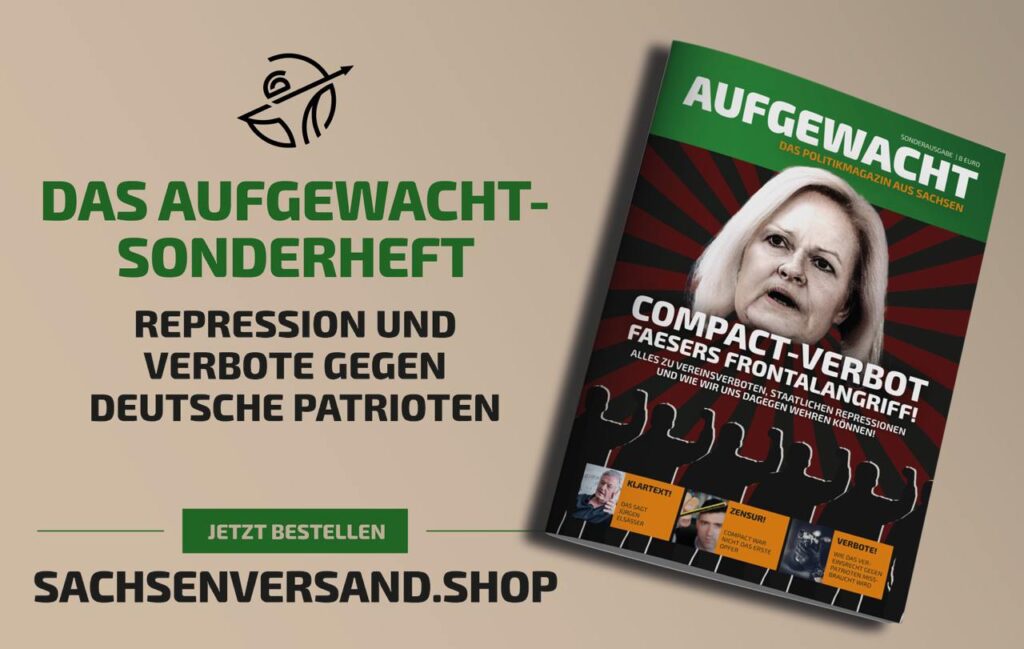
Der Berichterstatter Peter Müller – also der für dieses Verfahren wichtigste Richter – fragte in Richtung der beiden Politiker: „Hartz-IV-Beratung, Kinderfeste, Unterwanderung von Sportvereinen – wo ist da die Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung?“ Schon zuvor hatte sich selbst der vom Bundesrat benannte Sachverständige Dierk Borstel für eine Ablehnung des Antrags ausgesprochen. Spätestes hier machte sich sichtbar Verzweiflung in den Reihen der Antragsteller breit. Am 17. Januar 2017 wurde – wie von einer Mehrzahl der Prozessbeobachter erwartet – die Ablehnung des Antrags verkündet, was insbesondere auch als Erfolg der beiden NPD-Prozessbevollmächtigten Peter Richter und Michael Andrejewski gelten kann.
Dennoch bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Das Gericht beurteilte die NPD auf inhaltlicher Ebene nämlich als verfassungsfeindlich, aber als zu unbedeutend für ein Verbot. Die Richter rekurrierten dabei inbesondere auf den von der Partei vertretenen ethnischen Volksbegriff, mit dem heute das gesamte Spektrum rechts der Unionsparteien nach Herzenslust zusammenkartätscht wird. Insofern wurde damals an der NPD als erstes etwas exerziert, was danach den gesamten Rest der politischen Rechten ebenfalls mit voller Wucht betreffen sollte. Dennoch hat die mittlerweile in Die Heimat umbenannte NPD in Karlsruhe zwei Urteile erstritten, mit denen das Parteienprivileg – insbesondere im Vergleich zu den Verboten von SRP und KPD in den 50er Jahren – deutlich gefestigt wurde.
Arne Schimmer
Abonniert unseren Telegram-Kanal https://t.me/aufgewachtonline
Kostenlose AUFGEWACHT-Leseprobe herunterladen: https://aufgewacht-online.de/leseprobe/