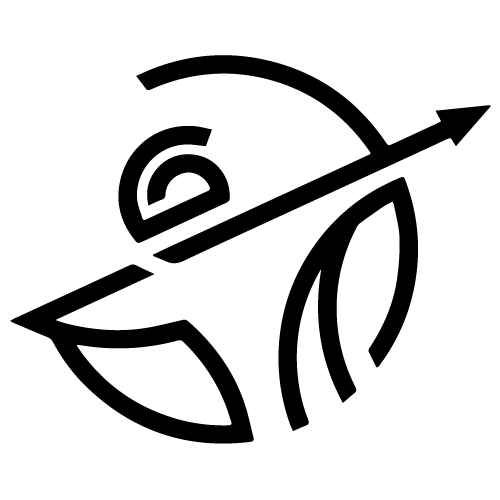Brisante Hintergründe, verschwiegene Tatsachen: In unserem Sonderheft „Die DDR – Geschichte eines anderen Deutschlands“ präsentieren wir Ihnen die Geschichte der DDR, wie Sie sie noch nicht kannten – garantiert! Hier bestellen!
Am 11. März 1985 begann ein Prozess, der für die Menschen in der Sowjetunion alles ändern sollte. Im Radio erklang Trauermusik von Chopin, die den Menschen in dem östlichen Riesenreich in den letzten Jahren sehr vertraut geworden war. Einen Tag davor war mit Konstantin Tschernenko der dritte Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion innerhalb von nur zweieinhalb Jahren verstorben. Das kommunistisch regierte Land hatte in den Jahren zuvor schon den Tod von Juri Andropow im Februar 1984 und von Leonid Breschnew im November 1982 verkraften müssen. Ein klaffendes Führungsvakuum schien sich aufzutun, vielen Menschen kam die Situation geradezu unwirklich vor. Nun verkündete der Sprecher im Radio, dass mit dem damals 54jährigen Michail Gorbatschow schon ein Nachfolger gewählt worden sei. Dieser wurde schon vom ersten Tag seiner Amtszeit an als äußerst ungewöhnliche Persönlichkeit empfunden.
Kommunist und Nonkonformist
Michail Gorbatschow wurde am 2. März 1931 in dem Dorf Priwolnoje im Nordkaukasus geboren. Die Region zählt zu den fruchtbarsten der damaligen Sowjetunion, was zu dieser Zeit allerdings auch eine große Gefahr darstellt. Sein Großvater wurde 1937 während der Zeit von Stalins Großem Terror verhaftet und wegen „Sabotage“ – ein Vorwurf, der damals zahlreichen Bauern gemacht wird – zum Holzfällen nach Sibirien deportiert. In Priwolnoje verhungert damals – so erinnerte sich jedenfalls Gorbatschow – jeder zweite Einwohner. Sein Vater muss wenige Jahre später als Soldat im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Der zehnjährige Michail ist nun der einzige Mann im Haus und liest seiner Mutter und den Großeltern täglich aus der Prawda vor. Der Glaube an den Kommunismus blieb in seiner Familie trotz aller durchlittenen Schrecken ungebrochen. 1952 wird er Vollmitglied in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU). Er geht zum Jurastudium an die Lomonossow-Universität in Moskau und lernt dort seine große Liebe Raissa kennen.
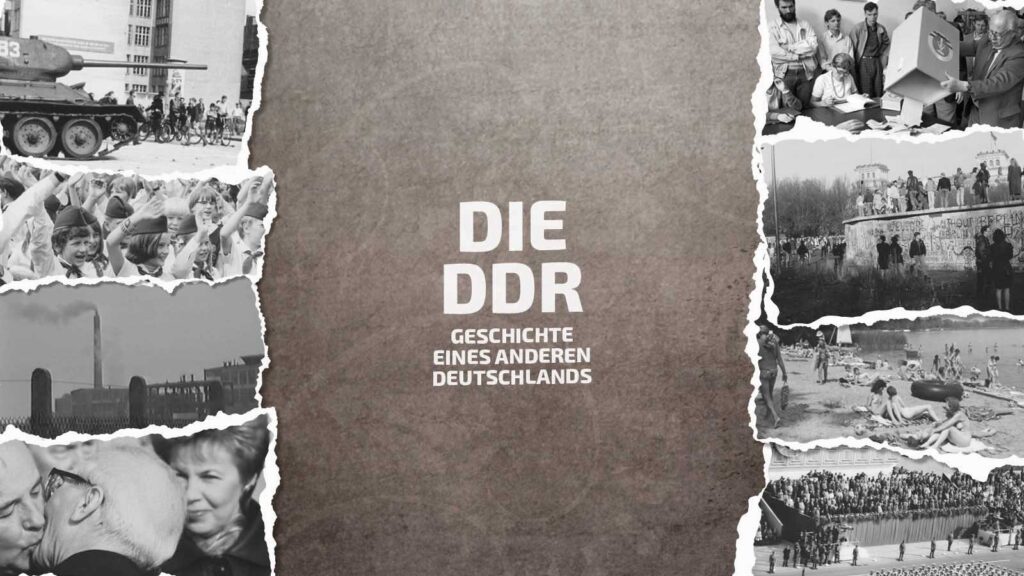
22 Jahre lang agiert er nun als Funktionär seiner Partei in der heimatlichen Region Stawropol – es sind die glücklichsten Jahre ihres Lebens, wie Raissa und Michail später betonen. Gorbatschow agiert sehr unkonventionell und macht lange Wanderungen durch die ihm anvertraute Region, um dort alle Bauern zu besuchen. So etwas hatte man dort zuvor von einem kommunistischen Funktionär nicht gesehen. Er modernisiert die landwirtschaftlichen Betriebe seiner Region und greift dabei auch auf die Erkenntnisse zurück, die er sich bei Auslandsreisen (beispielsweise nach Belgien und Ungarn) angeeignet hatte. Er erzielt damit außerordentlich gute Ergebnisse. Das fällt auch der Zentrale in Moskau auf. In den Stagnationsjahren der Ära des KPdSU-Generalsekretärs Leonid Breschnew sucht man einen Hoffnungsträger und findet ihn in Gorbatschow, der 1980 Vollmitglied des Politbüros wird. Ganz nach oben kommt er aber nur durch das historische Kuriosum des Tods dreier Generalsekretäre innerhalb kurzer Zeit.
Glasnost und Perestroika
Ein drittes Mal will die KPdSU-Führung nicht das Risiko eingehen, einen schwerkranken Mann an die Spitze eines Staates zu hieven, der ohnehin schon in einen immer maroderen Zustand verfällt. Also einigt man sich auf Michail Gorbatschow. Sein Programm umschreibt er mit den beiden Schlagworten „Glasnost“ (Offenheit) und „Perestroika“ (Umgestaltung). Sie zielen aber nicht auf eine einfache Übernahme eines westlichen Systems. Gorbatschow beruft sich ausdrücklich auf Lenins „Neue Ökonomische Politik“ der frühen 1920er Jahre, die dem Agrarsektor eine partielle Marktwirtschaft gestattete. Bis zu seinem Lebensende wird Gorbatschow sich als Kommunist bezeichnen. Außenpolitisch erzielt er im Zusammenspiel mit den beiden konservativen US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush Durchbrüche, die zum größten Abrüstungsschub der vergangenen 100 Jahre führen – und zwar insbesondere in dem für die Zukunft der Menschheit so wichtigen Sektor der Nuklearwaffen.

Von RIA Novosti archive, image #428452 / Boris Babanov / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0.
Als im Sommer 1989 mit der Grenzöffnung zwischen Österreich und Ungarn der Zerfall des Eisernen Vorhangs beginnt und ein Volksaufstand nach dem nächsten die osteuropäischen und ostmitteleuropäischen Staaten erschüttert, verzichtet er auf ein militärisches Eingreifen. Das ist und bleibt – man kann es nicht oft genug betonen – ein Wunder, das in der Weltgeschichte seinesgleichen sucht. Ein hochrangiger Staatsmann tötet den Machtmenschen in sich und gewährt Freiheit. Bei einem Besuch im Kaukasus im Juli 1990 holt sich der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl dann sogar noch Gorbatschows Einverständnis zur deutschen Wiedervereinigung. Innenpolitisch ist er weit weniger erfolgreich. Das sowjetische System ist so starr, dass es sich nicht mehr reformieren lässt. Vielmehr führt das Herausziehen einiger Karten nur dazu, dass das ganze Kartenhaus zusammenbricht. Die ohnehin schon angespannte Versorgungslage wird immer ernster und innerhalb des Riesenreichs brechen ethnische Konflikte (beispielsweise zwischen Armeniern und Aserbaidschanern) aus.
Die Auflösung der Sowjetunion
Dies führte dazu, dass Gorbatschow seine Macht während des nach drei Tagen zusammengebrochenen Augustputsches, der vom 19. bis zum 21. August 1991 währte, verlor. Diejenigen Kräfte, die das Machtmonopol der KPdSU erhalten wollten, setzten noch einmal alles auf eine Karte. Das von Wladimir Krjutschkow, dem Chef des mächtigen Geheimdienstes KGB, dominierte Notstandskomitee setzte die Gorbatschows in ihrer Datscha auf der Krim fest. Allerdings gelang es Boris Jelzin, dem Präsidenten der Russischen Teilrepublik, im Zentrum Moskaus die Massen hinter sich zu bringen und den Putsch zu beenden. Damit war allerdings nun er der neue starke Mann. Als Michail Gorbatschow wieder von der Krim nach Moskau zurückkehrte, hatte er nicht mehr viel zu sagen. Am 8. Dezember 1991 beendeten die Präsidenten der drei wichtigsten sowjetischen Teilrepubliken – Boris Jelzin für Russland, Leonid Krawtschuk für die Ukraine und Stanislaw Schuschkewitz für Weißrussland – mit den sogenannten Belowescher Vereinbarungen die Existenz der Sowjetunion und gründeten die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).
Diesen Schritt hatte Gorbatschow nie gehen wollen. Er spielte fortan die Rolle eines Elder Statesman, der vor allem im Westen populär war. Allerdings verurteilte auch er die Osterweiterung der NATO und verteidigte die 2014 erfolgte Annexion der Krim durch Russland. Michail Gorbatschow verstarb am 30. August 2022 in Moskau. Der Radikalökologe und DDR-Dissident Rudolf Bahro hatte Gorbatschow einmal hoffnungsvoll als „Fürsten der ökologischen Wende“ bezeichnet. Das war Gorbatschow zwar nicht, der Fürst einer bedeutenden weltgeschichtlichen Wende war er aber sehr wohl.
■ Arne Schimmer
Abonniert unseren Telegram-Kanal https://t.me/aufgewachtonline
Kostenlose AUFGEWACHT-Leseprobe herunterladen: https://aufgewacht-online.de/leseprobe/